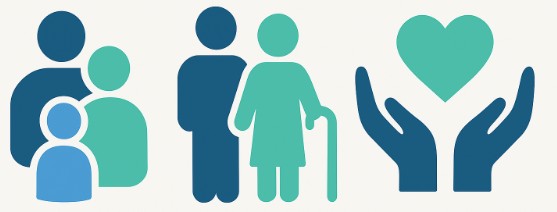Zwei Familienzentren der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin stehen vor dem Aus. Zum Jahresende sollen die Einrichtungen „Oase“ in Kyritz und „Mittendrin“ in Wusterhausen/Dosse ihren Betrieb einstellen. Nur zwei Beispiele. Bei etlichen Sozialträgern bundesweit setzt der Staat den Rotstift an. Ist damit das Prinzip der partnerschaftlichen Subsidarität gefährdet?
Privatisierung in der Daseinsvorsorge
Die Geschäftsführerin der Awo-Sozialgesellschaft im Landkreis nennt gestiegene Personalkosten und veränderte Förderbedingungen als Gründe für die bevorstehenden Schließungen. Bislang hatte der Landkreis sämtliche Personal- und Sachkosten übernommen. Diese volle Förderung soll nun auslaufen.
Die Geschäftsführung vermutet, dass hinter dem Schritt auch die derzeitige Haushaltssperre des Landkreises steht. Der Landkreis selbst verweist darauf, dass die Förderverträge regulär zum Jahresende enden und die verfügbaren Mittel künftig „bedarfsgerecht und zielgerichtet“ eingesetzt werden sollen.
Ziel sei es, Doppelstrukturen und Parallelangebote zu vermeiden. Die familienunterstützenden Maßnahmen müssten sich zudem an alle Familien im Flächenlandkreis richten – nicht nur an jene in den Kernstädten. Das klingt nach effizienter Neuordnung. Doch für die Awo bedeutet es vor allem das Ende zweier etablierter Anlaufstellen.
Orte der Begegnung drohen wegzufallen
Die Familienzentren sind weit mehr als nur ein Ort für Beratung und Unterstützung – sie dienen als soziale Treffpunkte, als geschützter Raum für Austausch, als Brücke zwischen Familien, Fachkräften und Gemeinde. Insbesondere in ländlich geprägten Regionen erfüllen sie eine wichtige Funktion.
Neben den Awo-Zentren ist auch die Zukunft weiterer Familienzentren in der Region ungewiss. In Rheinsberg und Wittstock/Dosse betreiben die Volkssolidarität und das Deutsche Rote Kreuz ähnliche Angebote.
Das unterstreicht ein strukturelles Problem: Die Finanzierung vieler sozialer Angebote ist nicht langfristig gesichert, sondern hängt oft von befristeten Projektmitteln oder haushaltspolitischen Entscheidungen ab. Gerade in Zeiten knapper Kassen geraten solche Strukturen schnell unter Druck – mit potenziell gravierenden Folgen für das Gemeinwesen.
Neue Wege, aber mit Risiken
Statt stationärer Einrichtungen sollen künftig mobile Angebote etabliert werden. Die Idee: mehr Flexibilität, weniger laufende Kosten. In der Theorie klingt das effizient, in der Praxis wirft es viele Fragen auf. Können mobile Teams tatsächlich dieselbe Vertrauensbasis aufbauen wie feste Einrichtungen mit gewachsenem Stammpersonal? Wie lassen sich spontane Kontakte, wie sie in einem offenen Treff möglich sind, in einem mobilen Format organisieren?
Die Awo zweifelt an der Machbarkeit. Der Verlust der vertrauten Räumlichkeiten sei nicht nur ein logistisches, sondern auch ein atmosphärisches Problem. Familienzentren leben von Kontinuität und einem sicheren Ort, an dem Kinder und Eltern gleichermaßen willkommen sind.
Prinzip der subsidiären Partnerschaft
Die öffentliche Daseinsvorsorge im Sozialbereich basiert in Deutschland seit Jahrzehnten auf dem Prinzip der subsidiären Partnerschaft: Der Staat finanziert und steuert – freie Träger leisten die Arbeit vor Ort. Diese Arbeitsteilung hat sich bewährt und wird zunehmend auch durch private Anbieter mitgestaltet. Entscheidend ist nicht die Rechtsform, sondern die Qualität der Hilfe und die Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen. Privatisierung in diesem Sinne heißt nicht Rückzug des Staates, sondern kluge Kooperation – mit klaren Regeln, fairen Partnerschaften und dem Ziel, junge Menschen bestmöglich zu unterstützen.
Zwischen Gemeinwohl und unternehmerischem Engagement
Wenn Kinder in Not geraten, Familien Unterstützung brauchen oder Jugendliche eine neue Perspektive suchen, ist der Staat gefragt. Genauer: die Kommunen. Nach §§ 1 ff. SGB VIII sind sie als öffentliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, Angebote der Förderung, Beratung und Betreuung bereitzustellen. Doch sie müssen diese Leistungen nicht zwingend selbst erbringen. Vielmehr können sie mit freien Trägern zusammenarbeiten – was in der Praxis längst die Regel ist. Diese Auslagerung gilt mitunter als Privatisierung – ist in der Kinder- und Jugendhilfe jedoch ein bewährtes und breit akzeptiertes Prinzip.
Freie Träger sind in der Regel Wohlfahrtsverbände wie die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie, AWO oder die Paritätischen Landesverbände. Sie arbeiten gemeinnützig, haben jahrzehntelange Erfahrung im Sozialbereich und sind eng mit der kommunalen Praxis verzahnt. Daneben gibt es jedoch auch privatwirtschaftlich organisierte Anbieter, die als GmbH oder gGmbH agieren. Sie unterliegen denselben gesetzlichen Anforderungen und müssen sich an den Hilfeplänen der Jugendämter orientieren.
Diese Trägerlandschaft ist Teil eines pluralen Systems, das – gewollt – auf Vielfalt, Fachlichkeit und Passgenauigkeit setzt. In der Praxis profitieren viele Kommunen davon, dass spezialisierte Anbieter differenzierte Betreuungsformen anbieten – etwa für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, Kinder mit Behinderungen oder bei akuter Kindeswohlgefährdung.
Beispiele aus der Praxis
- In Berlin kooperieren die Jugendämter mit über 800 freien Trägern – von kleinen Stadtteilvereinen bis hin zu bundesweit tätigen Organisationen.
- In Nordrhein-Westfalen betreibt die private „Step Kids Education GmbH“ Kindertageseinrichtungen im Auftrag mehrerer Kommunen – mit pädagogischen Konzepten, die staatlich zertifiziert sind.
- In Bayern arbeitet die Stiftung „Jugendhilfe aktiv“ mit Städten und Landkreisen zusammen, um stationäre Hilfen für Jugendliche mit herausforderndem Verhalten umzusetzen – inklusive Schulangebot und sozialpädagogischer Begleitung.
Diese Beispiele zeigen: Privatrechtliche Trägerschaft muss nicht im Widerspruch zum Gemeinwohl stehen. Viele Anbieter kombinieren unternehmerisches Handeln mit gesellschaftlichem Anspruch – etwa durch zusätzliche Angebote, innovative Betreuungskonzepte oder neue digitale Lösungen.
Vorteile eines offenen Systems
Für Kommunen kann die Zusammenarbeit mit freien Trägern – ob gemeinnützig oder wirtschaftlich – Flexibilität, Fachwissen und Entlastung bringen. Sie können auf bestehende Strukturen zurückgreifen, etwa wenn kurzfristig Plätze in stationären Einrichtungen benötigt werden. Auch bei regional unterschiedlichen Bedarfen bietet das gemischte System individuelle Lösungen.
Die Leistungserbringung erfolgt dabei immer unter staatlicher Aufsicht: Jugendämter bleiben für Hilfeplanung, Finanzierung und Qualitätsprüfung verantwortlich. Für alle Träger gelten die gesetzlichen Standards, etwa zu Fachkraftquoten, Betreuungsschlüsseln oder Schutzkonzepten.
Herausforderungen: Steuerung und Transparenz
Trotz der vielen positiven Erfahrungen gibt es auch Herausforderungen. Eine differenzierte Trägerlandschaft erfordert ein hohes Maß an kommunaler Steuerungskompetenz. Verträge, Qualitätsdialoge und Vergütungsverhandlungen müssen professionell gestaltet und kontrolliert werden. Gerade kleinere Kommunen brauchen hier personelle und fachliche Ressourcen.
Zudem ist es wichtig, die Öffentlichkeit über die Rolle freier Träger zu informieren. Denn nicht immer ist sichtbar, ob eine Einrichtung kommunal oder in freier Trägerschaft betrieben wird – und welche Verantwortung wem zukommt. Hier ist Transparenz gefragt, nicht Misstrauen.